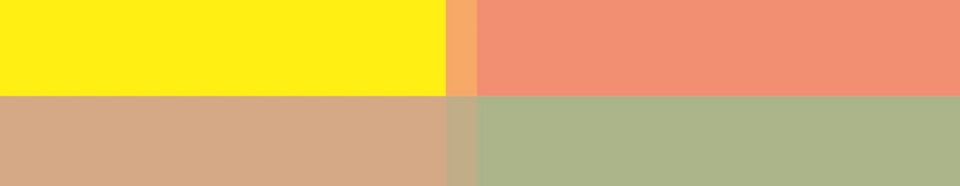Willi Winkler in der SZ zu Mikael Nilssons Aufsatz über „Hitlers Tischgespräche“ im Januarheft der VfZ
Das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung (21. Dezember 2018, online hier) hat einen ausführlichen Beitrag von Willi Winkler gebracht, der an Mikael Nilssons Aufsatz „‚Hitlers Tischgespräche‘ und ‚Monologe im Führerhauptquartier‘ – eine kritische Untersuchung“ aus der Januarausgabe der VfZ anknüpft. Winkler stuft Nilssons quellenkritische Analyse als „penibel recherchiert“ ein. Sie zeige, dass es bei den Hitler-Aufzeichnungen nie so etwas wie einen authentischen Text gegeben habe. Vor dem Hintergrund, dass 1951 die erste Ausgabe der „Tischgespräche“ von Gerhard Ritter im Auftrag des Deutschen Instituts für Geschichte der nationalsozialistischen Zeit herausgegeben wurde, das dann ab 1952 als Institut für Zeitgeschichte firmierte, bemerkt Winkler: „Es ehrt das Institut für Zeitgeschichte, dass es den Aufsatz Nilssons in seine Zeitschrift aufnimmt. Die Rolle, die das Institut bei der Veröffentlichung dieser Tischgespräche einnahm, bleibt allerdings unberücksichtigt.“
Das klingt nach einer moralischen Tat, die aber nur mit halbem Mut durchgeführt wurde, und es schwingt die Vorstellung von einem die Jahrzehnte überdauernden Institutskorpsgeist mit, dessen Überwindung Lob verdient, aber auch ein wenig Nachhilfe benötigt. In Wirklichkeit ist alles viel weniger spektakulär: Mikael Nilssons Aufsatz hat das übliche, sehr eingehende Qualitätskontrollverfahren der VfZ erfolgreich durchlaufen und wurde daher zur Publikation angenommen. Dass in dem Aufsatz die Geschichte der Erstausgabe der „Tischgespräche“ und die Rolle, die das Institut für Zeitgeschichte spielte, nicht behandelt wurden, hat zwei Gründe: Erstens folgt der Aufsatz stringent einem quellenkritischen Ansatz und thematisiert Überlieferungs- und Publikationsgeschichte nur da, wo es für diese Fragestellung sinnvoll ist. Zweitens ist die Publikationsgeschichte der „Tischgespräche“ in der Forschung schon eingehend untersucht worden, insbesondere von Winfried Schulze in seiner Monografie „Deutsche Geschichtswissenschaft nach 1945“ (1989) und noch detaillierter von Christoph Cornelißen in seiner 2001 erschienen Biografie über Gerhard Ritter (Gerhard Ritter. Geschichtswissenschaft und Politik im 20. Jahrhundert).
Wer diese Bücher zur Hand nimmt, erhält allerdings ein etwas anderes Bild von der Publikationsgeschichte der „Tischgespräche“ und der Rolle des IfZ, als Winkler sie den Leserinnen und Lesern der SZ präsentiert. Bei ihm stellt sich der Vorgang so da: Institutsleiter Hermann Mau „dekretiert“, der Wert der Notate für die historische Erkenntnis der Persönlichkeit Hitlers könne gar nicht überschätzt werden. Weiter: „Der Historiker Gerhard Ritter fungierte als Herausgeber und verfasste eine Einleitung“, heißt es weiter, ohne dass der Leserschaft erklärt würde, wer dieser Ritter war und in welcher Beziehung er zum IfZ stand. Zu Recht weist Winkler darauf hin, dass Ritter die – wie Nilsson zeigt, in der Regel aus der Retrospektive verfassten – Aufzeichnungen des Stenografen und Hitler-Bewunderers Henry Picker unkritisch und unkommentiert präsentierte. Auch das nicht allzu inhaltsschwere Nachwort schuf hier keine Abhilfe, ja es ließ an manchen Stellen den Eindruck mangelnder Distanz zur historischen Figur „Hitler“ entstehen. Das brachte Ritter harsche Kritik ein, unter anderem von Hannah Arendt. Sie warf ihm vor, sich vor der Aufgabe gedrückt zu haben, an die Aufzeichnungen von Hitlers gezielt an seine militärische Zuhörerschaft gerichteten Äußerungen denselben kritischen Maßstab wie bei anderen Dokumenten anzulegen und so „die prinzipiell lügenhafte Natur dieser Reden“ zu zeigen (ein Prinzip, dem übrigens die viel diskutierte „Mein Kampf“-Edition des IfZ peinlich genau folgt). Wie Winkler erläutert, reagierte Ritter auf diese Kritik mit einem ausführlichen Brief an die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Instituts. Dabei sei der als „deutschnationaler Rechthaber“ charakterisierte Ritter „ausfallend, wenn nicht antisemitisch“ geworden, meint Winkler, was er mit einigen markanten Zitaten illustriert und mit dem Hinweis ausklingen lässt: „Das Institut für Zeitgeschichte hat sich eine Erforschung seiner eigenen Geschichte vorgenommen.“
Das ist dann wohl eine geglückte journalistische Zuspitzung, allerdings auf Kosten des historischen Kontexts. So steht am Anfang der Geschichte nicht der Institutsleiter Mau, sondern Gerhard Ritter. Der nationalkonservative Geschichts-Ordinarius aus Freiburg war Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Instituts. Am 22. Januar 1951 hatte er eine Anfrage des Athenäum -Verlags erhalten, ob er die Einleitung zu den „Tischgesprächen“ übernehmen wolle, und sofort zugestimmt. Nur knapp drei Wochen später machte er dem wissenschaftlichen Beirat und dem Kuratorium des Deutschen Instituts zur Erforschung der nationalsozialistischen Zeit den Vorschlag, die „Tischgespräche“ als erste Publikation des Instituts herauszubringen, was auch dessen Bekanntheit nützen würde. Das stieß offenkundig auf Zustimmung, skeptische Stimmen wie die des Buchenwald-Überlebenden und Verfassers der KZ-Studie „Der SS-Staat“, Eugen Kogon, drangen nicht durch. Die Stimmung drehte sich aber schon vor dem Erscheinen des Buchs, als in der Illustrierten „Quick“ eine sensationalistisch aufgemachte Vorabveröffentlichung erschien, die in der Politik bis hin zum Bundeskanzler Missfallen erregte. Am 11. August äußerte sich der Historiker und damalige Redenschreiber des bayerischen Ministerpräsidenten Ehard, Ernst Deuerlein, in der „Bayerischen Staatszeitung“ äußerst kritisch. Als in der Oktoberausgabe der Kulturzeitschrift „Der Monat“ Hannah Arendts Fundamentalkritik „Bei Hitler zu Tisch“ erschien, wurde in einem Kasten eigens auf diesen Artikel sowie viele andere kritische Stimmen „gegen die bedenkliche Jungfernpublikation des Münchener Instituts“ verwiesen. Auch in den Institutsgremien gab es verstärkt kritische Einschätzungen. Ritter, der mit seinen Vorstellungen von der Organisation und Ausrichtung des Instituts bereits in eine Randposition geraten war, war es mit seinem Rechtfertigungsbrief an die Beiratsmitglieder nicht gelungen, die Kritik nachhaltig zu entkräften. Nach kontroversen Diskussionen in den Gremien im November 1951 wurde ihm vielmehr der Rückzug aus dem Beirat nahegelegt. Er kam dem zwar nicht formell, aber in der Praxis nach: Bis zum Auslaufen seines Mandats 1955 beteiligte er sich nicht mehr an der Arbeit und blieb allen Sitzungen fern.
Die Geschichte der Veröffentlichung der „Tischgespräche“, noch dazu als „Jungfernpublikation“ des IfZ, ist gewiss problematisch. Aber es ist doch in wesentlichen Zügen eine andere Geschichte als die Story, die Winkler präsentiert.
jz